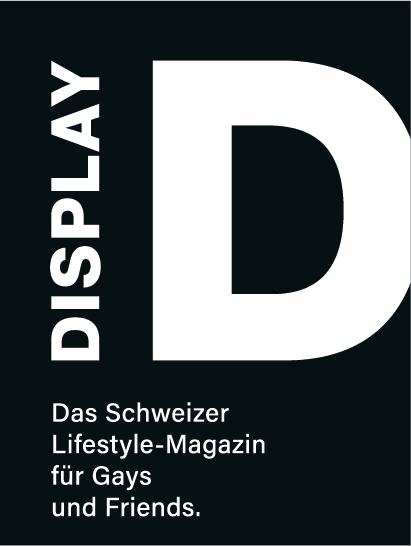Queere Geflüchtete in der Schweiz: André Rosselet ist der Anwalt der Entrechteten. Im DISPLAY-Interview schildert er die Probleme, denen queere Geflüchtete begegnen.
Auch in der Schweiz sind queere Geflüchtete mit einer Realität konfrontiert, die von Unsicherheit und Ausgrenzung geprägt ist. Nach einer oft lebensbedrohlichen Flucht erwartet sie ein langwieriges Asylverfahren – begleitet von rechtlicher Unsicherheit, belastenden Unterbringungsbedingungen und gesellschaftlicher Isolation. Besonders in den Asylzentren mangelt es an Schutzräumen und Sensibilisierung für ihre Bedürfnisse.
DISPLAY hat mit Pierre André Rosselet gesprochen. Er ist Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Stonewall und engagiert sich als Rechtsanwalt für die Rechte von queeren Geflüchteten. Im Interview berichtet er über die Herausforderungen, mit denen er konfrontiert ist – und warum es dringend Veränderungen braucht.
Interview Christian Gersbacher
DISPLAY: Herr Rosselet, Sie engagieren sich seit vielen Jahren für die Rechte von queeren Geflüchteten in der Schweiz. Was hat Sie persönlich dazu bewegt?
Pierre André Rosselet: Es kamen sensible, liebevolle Menschen (meist Männer) zu mir, die sehr unter der teils extremen Homophobie in ihrer Heimat litten. Ein junger Mann berichtete davon, dass er schon als Kind von seinem Vater misshandelt und verstossen wurde, weil er «zu weiblich» sei, noch bevor er überhaupt wusste, was Homosexualität ist. Es geht dabei nicht nur um die Verfolgung durch den Staat und die Polizei, sondern auch um Erniedrigung und gewalttätige Angriffe durch das familiäre Umfeld und eine von Macho-Kultur geprägte Gesellschaft.
«Im Asylverfahren können noch immer viele nicht glauben, dass sie hier vor Staatsbeamten und Polizistinnen offen sagen können, dass sie schwul oder lesbisch sind. Sie erfinden dann irgendeine Geschichte von politischer Verfolgung.»
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für queere Geflüchtete in der Schweiz – sowohl rechtlich als auch gesellschaftlich?
Rechtlich gesehen ist es schwierig, die «individuelle Verfolgung» im Heimatland zu beweisen. Es genügt nämlich nicht, aus einem queerfeindlichen Land zu stammen, in dem die Geflüchteten meist im Versteckten gelebt haben. Kommen sie dann auch noch aus einem Staat, in dem generell Unsicherheit und Gewalt herrschen, wie zum Beispiel Venezuela, werden gewalttätige Angriffe, Raubüberfälle, Entführungen und so weiter schnell einmal als Ausdruck der allgemein schlechten Sicherheitslage abgetan und nicht als Zeichen der Verfolgung. Gesellschaftlich sind sie gleich mit zwei Herausforderungen konfrontiert: Einerseits mit der allgemeinen, gegen Flüchtende aus fremden Kulturen gerichteten Stimmung, und anderseits mit der zum Teil auch bei uns immer noch vorhandenen Homophobie.
Welche Hürden stehen LGBTQ+-Geflüchteten im Asylverfahren im Weg?
Im Asylverfahren können noch immer viele nicht glauben, dass sie hier vor Staatsbeamten und Polizistinnen offen sagen können, dass sie schwul oder lesbisch sind. Sie erfinden dann irgendeine Geschichte von politischer Verfolgung, welche die Behörden leicht als falsch entlarven können. Glaubwürdigkeit der Person sowie Glaubhaftigkeit und Beweisbarkeit der Erzählung ist jedoch das «A und O» des Asylverfahrens und entscheidet früh über die Chancen auf Asyl oder wenigstens vorläufige Aufnahme.
In den Unterkünften leben ja offenbar auch viele Menschen aus Macho-Kulturen?
Ja, in den Unterkünften ist die Situation um Teil katastrophal. Der grösste Teil der Geflüchteten besteht aus Hetero-Männern aus extrem queerfeindlichen Kulturen. Das Personal ist zu wenig zahlreich und nicht für die besonderen Herausforderungen der queeren Geflüchteten ausgebildet. Queere Geflüchtete haben oft einen höheren Bedarf an medizinischer Versorgung, insbesondere Psychotherapie. Ein Problem, das kaum ernstgenommen wird. Im Argen liegen in manchen Asylzentren auch die hygienischen Verhältnisse.
Was müsste sich Ihrer Meinung nach politisch und strukturell in der Schweiz ändern, um queere Geflüchtete besser zu schützen und zu unterstützen?
Wir brauchen weniger Vorurteile und weniger bürokratische Sturheit. Während allgemein Flüchtende aus fremden Kulturen als grosse, angsteinflössende Gruppen wahrgenommen werden, sind queere Geflüchtete meist auf sich allein angewiesen. Ohne den Schutz einer Gruppe oder Familie, flüchten sie allein oder allenfalls als Paar. Sie sind deshalb besonders motiviert, sich zu integrieren, vor allem, wenn sie merken, dass ihr Queersein hier besser akzeptiert ist als in ihrer Heimat. Oft besitzen sie auch eine gute Schul- oder berufliche Bildung. Es ist ihnen gut möglich, Kontakte zu befreundeten Menschen in der Schweiz zu knüpfen, die ihnen dann sogar freie Kost und Logis anbieten.
Gibt es positive Entwicklungen oder rechtliche Fortschritte, die Hoffnung machen?
Einerseits den neuesten Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Darin wurde nicht nur gesagt, die Schweiz dürfe von einem geflüchteten Schwulen nicht verlangen, sich verstecken zu müssen, sondern auch, dass es auf Dauer gar nicht möglich ist, seine Homosexualität zu verbergen. Positiv ist auch, dass beispielsweise Fachpersonen von Queer Amnesty und anderen Organisationen nun Kurse für Personal von Asylzentren und Befragende geben können. Dies ist zumindest ein zaghafter Anfang.
Was wünschen Sie sich von der queeren Community – aber auch von der Gesellschaft insgesamt – im Umgang mit LGBTQ*-Geflüchteten?
Von der queeren Community erhoffe ich mir eine noch grössere Offenheit und Hilfsbereitschaft gegenüber queeren Geflüchteten. Die Hilfe kann von der finanziellen Unterstützung beispielsweise von Queer Amnesty, der Stiftung Stonewall oder weiteren ähnlichen Organisationen bis zum Angebot von Kost und Logis gehen. Auch ein menschlicher Kontakt, ein Treffen zum Kaffee, kann den queeren Flüchtenden das Leben bereichern.
Von der Gesellschaft insgesamt erhoffe ich mir, dass sie das wirtschaftliche und gesellschaftliche Potenzial der queeren Flüchtenden anerkennt. Die meisten von ihnen haben eine gute Ausbildung, lernen unsere Sprache schnell und integrieren sich dank ihrer ausgeprägten Anpassungsfähigkeit gut.
Engagement in der Stiftung Stonewall
Sie engagieren sich auch im Stiftungsrat der Stiftung Stonewall. Können Sie uns mehr über Ihre Rolle dort erzählen – und über die Ziele, die Sie mit der Stiftung verfolgen? Welches sind aktuelle oder zukünftige Projekte?
Ich gehöre zum Stiftungsrat. Wir treffen uns regelmässig alle paar Monate, um über die finanzielle Unterstützung von Projekten aus Kultur, Wissenschaft, Bildung und Gesellschaftspolitik zu entscheiden, welche die Situation von queeren Menschen aufzeigen und verbessern. Die Projekte, die uns vorgelegt werden, sind sehr vielfältig. Zum Beispiel haben wir 2024 die Publikation der Lebensgeschichte des «Secondos» Joe Bürli unterstützt, der auf ein langes Leben als schwuler Mann in der Schweiz zurückblicken kann. Auch haben wir Förderbeiträge an das Schulprojekt «DiversityExists» ausgerichtet, insbesondere zur Herstellung des Films, der an Schulen und Bildungsstätten gezeigt wird. Schliesslich vergeben wir zusammen mit einer ExpertInnen-Jury den «Stonewall Award».