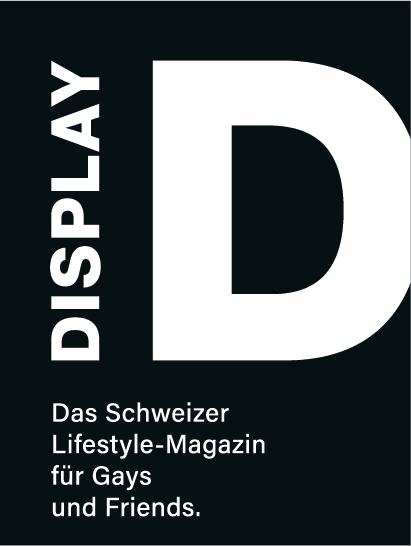«Der «Queer Palm»-Gewinner aus Cannes kommt am 11. September endlich ins Kino.
Von Dieter Osswald
Das titelgebende Ende der Welt befindet sich mitten in Europa. Genauer gesagt in Rumänien, auf einer kleinen, idyllischen Insel mitten im Donaudelta. Vor dieser schönen Naturkulisse herrschen allerdings hässliche Zustände. Religiöser Fanatismus und korrupte Strukturen bis in die Polizei beherrschen das Bild. Vorurteile bestimmen das Denken.
Als ein jugendlicher Schwuler das Opfer brutaler Gewalt wird, wenden sich seine bislang liebevollen Eltern von ihm ab. Der einflussreiche Vater der Täter will das Verbrechen mit allen Mitteln vertuschen.
Der mit maximalem Minimalismus eindrucksvoll inszenierte, rigorose Coming-of-Age-Thriller «Three Kilometers to the End of the World» wurde in Cannes prompt mit der «Queer Palm» prämiert.
Rätselhafte Gewalttat
Ein Meeresstrand im morgendlichen Sonnenlicht des Donaudeltas – so malerisch schön beginnt dieses Coming-of-Age-Drama. Die Postkarten-Idylle erweist sich jedoch schnell als trügerisch. Ein verzweifelter Vater macht sich Sorgen, weil er seine Schulden beim lokalen Bonzen nicht rechtzeitig zurückzahlen kann.
Da kehrt sein 17-jähriger Sohn Adi brutal verprügelt nach Hause zurück. War die Gewaltorgie ein Denkzettel für den verpassten Zahlungstermin? Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf, ein Arzt untersucht akribisch genau das Opfer – befremdlicherweise in Anwesenheit von Familie und Staatsmacht.
Schnell finden sich erste Zeugen der Tat, die aus Angst vor Schwierigkeiten jedoch offiziell lieber schweigen. Die Spur führt zu den Söhnen des lokalen Strippenziehers. Die brüsten sich gerne mit der Tat: «Weil er eine Schwuchtel ist. Weil er in den Arsch gefickt wird!» – «Sollen wir das so aufschreiben?», will der Polizist fürs Protokoll von seinem Chef wissen.

Das Schwulsein «austreiben»
Die Eltern reagieren auf das Schwulsein ihres Sohnes mit Panik und Unverständnis. «Warum? Warst du betrunken?», will die heulende Mama wissen. Der sensible Teenager schweigt. Als der herbeigerufene Pfarrer zum Exorzismus schreitet, wird Adi von den religiösen Fanatikern gefesselt und geknebelt. «Wir sollten den Sünder in einem Kloster unterbringen», schlägt der «Gottesmann» vor.
Als sich eine resolute Dame vom Jugendamt in den Fall einschaltet, scheint eine Wendung der Dinge in Sicht. Doch die Arme des lokalen Bonzen reichen bis zu den Behördenchefs auf dem Festland. Zum Glück kann der von allen Seiten malträtierte Teenie auf die Hilfe seiner besten Freundin zählen.
Repression in Rumänien
Regisseur Emanuel Pârvu präsentiert ein beklemmend düsteres Porträt seiner Heimat Rumänien. Ein Sumpf aus staatlicher Korruption, religiösem Fundamentalismus sowie aggressivem Homohass scheint gesellschaftlicher Standard in diesem EU-Land zu sein. Unter solch widerwärtigen Bedingungen ist es für sensible Jugendliche auf dem Land schier unmöglich, ihre Träume von einem selbstbestimmten Leben zu verwirklichen.

Pârvu setzt in seinem Coming-of-Age-Thriller souverän auf Minimalismus und dramaturgischen Mut zur Lücke. Was Adi mit seinem Bekannten in jener Nacht tatsächlich gemacht hat, bleibt unerwähnt. Ebenso sind die dubiosen Geschäfte des lokalen Bonzen so nebulös wie die Aktivitäten seiner gewalttätigen Söhne.
Kafkaesk wirkt die Staatsmacht. Bürokratisch penibel wird für jede Aussage unbedingt eine Unterschrift benötigt, damit sie verwertet werden kann. Derweil finden die ärztliche Untersuchung des Opfers oder Befragungen durch das Jugendamt befremdlich indiskret, vor allen Leuten, statt.
Als Kontrast zu den chronischen Missständen der Gesellschaft setzt der Film immer wieder die malerische Naturkulisse des Donaudeltas ein. Ein paradiesisch schöner Ort zum Leben, zugleich die Hölle für alle Aussenseiter. Von Toleranz und Liberalität fehlt jede Spur in diesen korrupten Clan-Strukturen. Die unaufgeregte Dramaturgie zeigt die kollektive Homonegativität als normalen Alltag und macht die Hexenjagd umso beklemmender. Die überzeugenden Darsteller sorgen für zusätzliche Gänsehaut in diesem cineastischen Aufschrei mit Klassiker-Potenzial.
Regisseur Emanuel Pârvu: «Entscheidend ist nur, ob du Gutes oder Böses tust»
DISPLAY: Herr Pârvu, was bedeutet die Queer Palm für Sie?
Pârvu: Sie hat mich überrascht. Zugleich ist die Queer Palm wichtig, weil sie dem Film die Möglichkeit gibt, mehr Aufmerksamkeit zu erregen als sonst.
 Wie waren die Reaktionen in Ihrer Heimat? Mehr Stolz oder eher Ablehnung?
Wie waren die Reaktionen in Ihrer Heimat? Mehr Stolz oder eher Ablehnung?
In den Grossstädten wurde die Palme geschätzt. Ausserhalb der Zentren waren die Reaktionen wie bei der extremen Rechten. Ich habe in sozialen Medien Nachrichten bekommen, in denen hässliche Worte über mich und meine Familie fielen. Vielleicht ändert sich die Ablehnung, wenn diese Leute sich den Film erst einmal ansehen. Der Film ist genau für diese Leute gemacht, um sie dazu zu bringen, erst einmal nachzudenken, bevor sie den Mund aufmachen.
Wie kamen Sie zu dem Thema?
Ich finde es wichtig für zukünftige Generationen, über Integration Bescheid zu wissen. Ob wir über Rassismus, Homophobie oder all die schlechten Dinge auf diesem Planeten sprechen, sie müssen für alles offen sein. Die Hautfarbe, die Religion und die sexuelle Orientierung spielen keine Rolle. Entscheidend ist nur, ob du in dieser Welt Böses tust oder Gutes.
Das klingt etwas pädagogisch…
Mein Beruf ist tatsächlich Lehrer. Ich bin Dozent an der Uni und Schauspiellehrer. Mir liegt viel daran, dass die Jungen, insbesondere in unserem Land, verstehen, was wir vor der Revolution im Kommunismus durchgemacht haben. Es ist wichtig, die Freiheit so zu geniessen, wie sie ist. Ich wollte einen Film über die Liebe machen. Liebe sollte bedingungslos sein. Wir sollten frei über Liebe sprechen. Denn sonst sind wir, wie der Titel sagt, drei Kilometer vom Ende der Welt entfernt
Warum ist Homonegativität in den Balkanländern so ausgeprägt?
Wenn wir über Religion sprechen, werden die Leute verwirrt, weil sie Glauben mit Religion verwechseln. Glaube ist meiner Meinung nach wichtig. Religion könnte uns eine Perspektive eröffnen, aber sie ist zu eng. Glauben bedeutet, sich zu öffnen, zu glauben und zu sprechen. Religion bedeutet Abschottung. Das Gesetz gegen Homosexualität wurde in Rumänien erst 1999, zehn Jahre nach der Revolution, abgeschafft. In der kommunistischen Ära drohte dafür eine Gefängnisstrafe. Das ist beängstigend. Wobei Homophobie nicht nur die Balkanländer betrifft, wie der aktuelle Blick in die USA zeigt.
Was hat Sie persönlich geprägt?
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die viele Freunde aus der queeren Szene hatte, vor allem Regisseure und Schauspieler, die alle zu uns nach Hause kamen. Meine Familie hat mir beigebracht, offen zu sein und Menschen nicht nach ihrem Aussehen oder ihrer Orientierung zu beurteilen. Das ist wichtig, wenn wir eine lebenswerte Gesellschaft haben wollen.
Ihr Stil ist minimalistisch. Vieles bleibt offen. Was hat es mit dem dramaturgischen Mut zur Lücke auf sich?
Das habe ich von Hitchcock übernommen. Dieser grossartige Regisseur zeigt nicht, was passiert, sondern konzentriert sich auf die Gedanken des Publikums. Nehmen wir an, Sie haben Angst vor Bienen und ich habe Angst vor Pferden. Wenn Sie etwas wie eine Biene auf der Leinwand sehen, werden Sie Angst haben und ich werde lachen. Hitchcock zeigt das Monster nie. Er macht es immer durch Geräusche oder lässt das Publikum entscheiden.
Was bedeutet das für Ihre eigene Herangehensweise?
Das Monster entsteht in unseren Köpfen. Ich überlasse es der Phantasie des Publikums. Eine Tracht Prügel sieht in meiner Vorstellung anders aus als bei einer 30-jährigen Frau. Ich vertraue meinem Publikum so sehr, dass ich es entscheiden lasse, wie die Dinge hinter dem Geschehen aussehen.
«Three Kilometers to the End of the World» läuft ab dem 11. September in ausgewählten Kinos der Deutschschweiz.